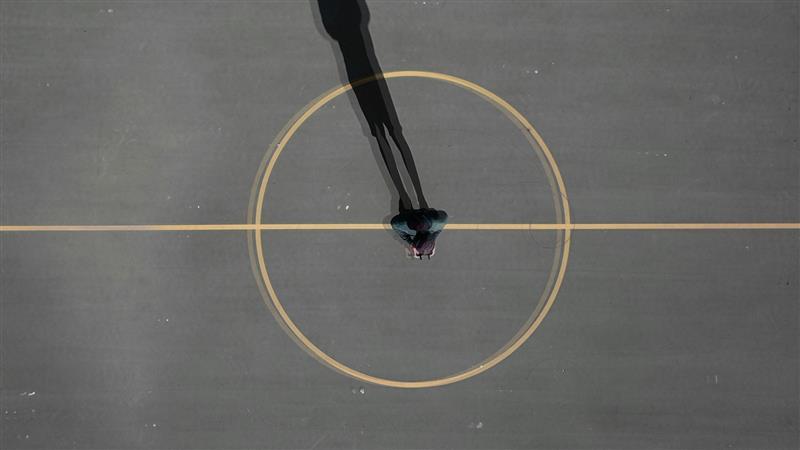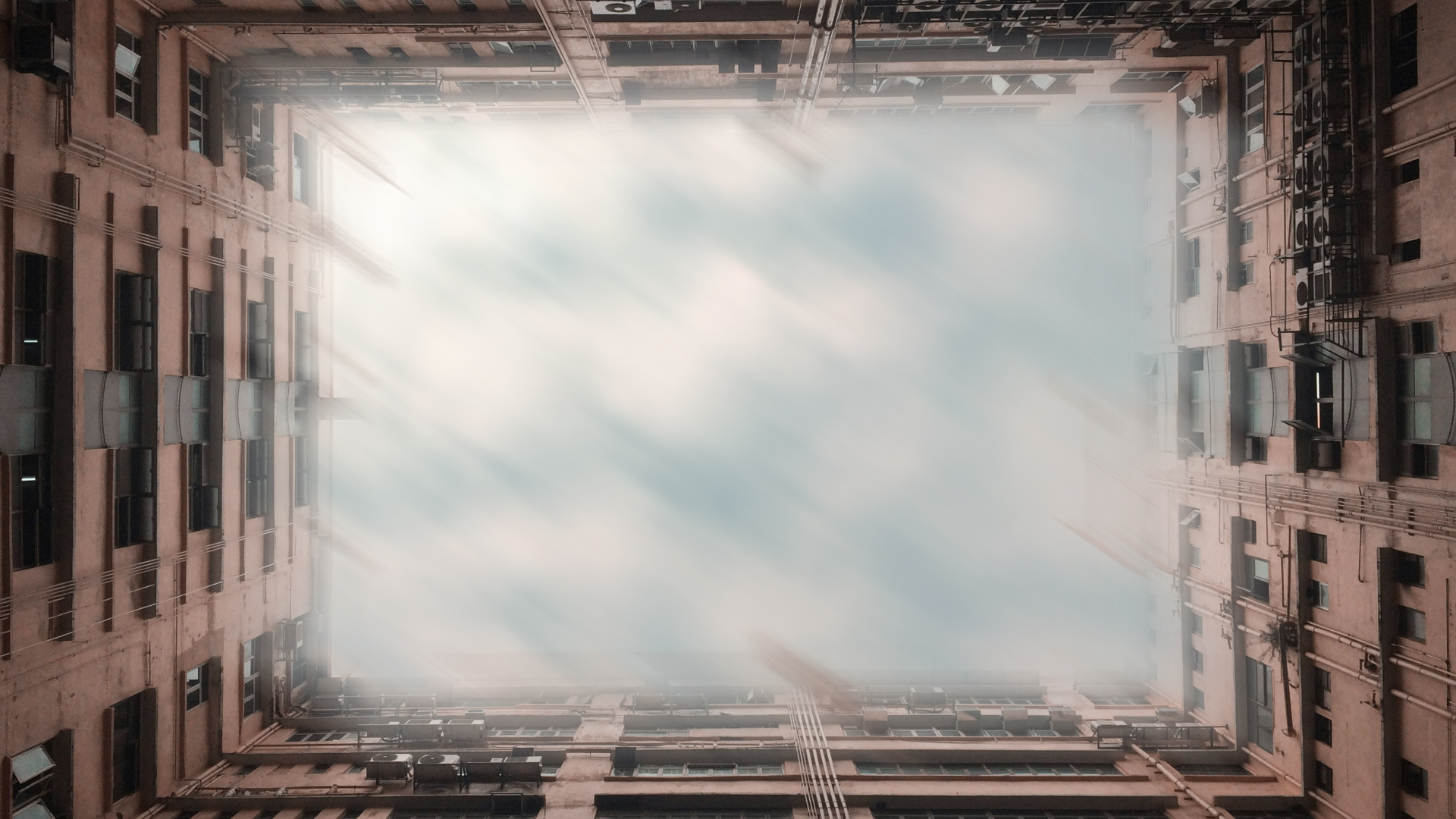Die Verhältnisse prägen das Verhalten

Im triljen-Podcast spricht David Agert, Diplom-Pädagoge, Systemischer Organisationsentwickler und Mitglied der Geschäftsführung von PRAXISFELD, über die Kunst, Organisationen so zu gestalten, dass Verhalten nicht dem Zufall überlassen bleibt.
Warum verhalten sich Mitarbeitende, wie sie sich verhalten? Und was können Unternehmer tun, um Strukturen zu schaffen, die Leistung, Zusammenarbeit und Verantwortung fördern?
David Agert beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit diesen Fragen. Im Gespräch mit Joachim Schwichtenberg erklärt er, warum sich Organisationen nicht wie Maschinen steuern lassen, was hinter dem Satz „Die Verhältnisse bestimmen das Verhalten“ steckt – und weshalb die Arbeit am Organisationsdesign weit mehr ist als Kästchenschieben im Organigramm.
Hören Sie das Interview in voller Länger in unserem triljen-Podcast:
Lesen Sie hier die Zusammenfassung:
Organisationen sind keine Maschinen – sie sind lebende Systeme
Joachim Schwichtnberg (triljen): David, Du begleitest Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten in Veränderungsprozessen. Was beschäftigt Dich im Moment besonders?
David Agert (Praxisfeld): Mich treibt im Grunde seit Jahren dieselbe zentrale Frage an: Was müssen Organisationen heute tun, um morgen erfolgreich zu sein? Diese Frage bleibt aktuell, egal ob in einem mittelständischen Produktionsbetrieb oder in einer sozialen Einrichtung. Es geht darum, wie Organisationen unter veränderten Bedingungen bestehen – und wie sie sich anpassen, ohne sich selbst zu verlieren.
Hat sich in dieser Zeit verändert, wie Du auf Organisationen schaust?
Teilweise. In den 1990ern und frühen 2000ern war das Denken über Organisationen sehr stark von mechanischen Bildern geprägt. Man glaubte: Wenn ich Menschen im Organigramm neu sortiere und Prozesse definiere, dann läuft das schon. Heute wissen wir: Organisationen sind keine Maschinen, sondern lebende Systeme. Sie bestehen aus Menschen, Beziehungen, Entscheidungen – und Kommunikation. Steuerung funktioniert da nicht linear. Du kannst Verhalten nicht befehlen, sondern nur Rahmenbedingungen schaffen, die bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher machen.
„Wer die Organisation versteht, versteht auch das Verhalten seiner Leute“
Was heißt das konkret für die Praxis – gerade im Mittelstand?
Das bedeutet, Du kannst als Unternehmer nicht einfach an Stellschrauben drehen und erwarten, dass das System linear reagiert. Du kannst aber sehr wohl Bedingungen gestalten, die ein gewünschtes Verhalten fördern. Beispiel: Wenn Du möchtest, dass Deine Leute eigenverantwortlich handeln, brauchst Du Strukturen, die das ermöglichen – also klare Entscheidungsräume, Vertrauen und nachvollziehbare Regeln. Wenn Du das Gegenteil tust, also jede Entscheidung zentralisieren willst, erstickst Du Eigenverantwortung im Keim. Die Verhältnisse prägen das Verhalten.
Das heißt, Organisationen sind nicht das, was im Organigramm steht?
Genau. Das Organigramm zeigt die formale Seite – also wer wem berichtet, wer welche Rolle hat, wer über was entscheidet. Aber jede Organisation hat auch eine informelle Seite: Trampelpfade, Routinen, Gewohnheiten. Sie entstehen immer dort, wo formale Regeln nicht ausreichen.
Ein Beispiel: Eine Regel besagt, dass jede Dienstreise genehmigt werden muss. In der Praxis dauert der Prozess so lange, dass der Termin vorbei ist, bevor die Genehmigung da ist. Also fahren Mitarbeitende einfach los – und holen die Bestätigung nach. Formell ist das Regelverstoß, faktisch aber oft vernünftig. Solche Workarounds zeigen, dass Verhalten aus den Verhältnissen entsteht – nicht aus Appellen.
„Führung heißt: Verhältnisse gestalten, nicht Verhalten einfordern“
Viele Führungskräfte fordern Werte wie Kollegialität oder Eigenverantwortung ein. Du würdest sagen: Das ist der falsche Ansatz?
Zumindest ein unvollständiger. Ich kann niemandem sagen: „Sei bitte ab morgen kollegialer.“ Das wirkt schnell zynisch. Ich kann aber Bedingungen schaffen, die Kollegialität begünstigen. Wenn ich zum Beispiel Einzelleistung belohne und Teamleistung ignoriere, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn jeder für sich arbeitet. Wer Zusammenarbeit will, muss auch Strukturen schaffen, die Zusammenarbeit lohnend machen – materiell und emotional.
Das klingt sehr systemisch gedacht. Welche Rolle spielt die Systemtheorie für Deine Arbeit?
Eine große. In der Systemtheorie sagen wir: Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sondern aus Entscheidungen und Kommunikation. Wenn nichts mehr entschieden wird, gibt es die Organisation im eigentlichen Sinn nicht mehr. Entscheidungen sind also der Herzschlag des Systems. Und das bringt uns zur nächsten wichtigen Idee – den sogenannten Entscheidungsprämissen.
„Entscheidungsprämissen sind die DNA einer Organisation“
Was genau sind Entscheidungsprämissen?
Das sind die Vorentscheidungen, die festlegen, wie in einer Organisation später entschieden und gehandelt wird. Man kann sagen: Sie sind die DNA einer Organisation.
Es gibt vier zentrale Arten:
-
Programme – also Strategie, Ziele, Zweck.
-
Kommunikationswege und Entscheidungsstrukturen – das, was wir klassisch als Organisationsdesign bezeichnen.
-
Personen – also prägende Persönlichkeiten, deren Haltung Einfluss auf das System hat.
-
Kultur – also die informellen Werte, Routinen und Selbstverständlichkeiten.
Diese vier Prämissen greifen ineinander. Wenn Du also feststellst, dass Verhalten in Deinem Unternehmen nicht zu den Zielen passt, lohnt es sich, genau hier zu suchen: Welche dieser Prämissen wirken gerade – und wie kann ich sie bewusst verändern?
Klingt abstrakt – kannst Du das an einem Beispiel aus der Praxis verdeutlichen?
Nehmen wir ein Familienunternehmen, das seit Jahrzehnten stark von einer Unternehmerpersönlichkeit geprägt ist. Diese Person entscheidet vieles selbst, kennt jeden Kunden, jede Maschine, jede Zahl. Das funktioniert, solange sie da ist. Wenn sie abtritt, entsteht ein Vakuum. Die bisher dominante Entscheidungsprämisse „Person“ fällt weg. Jetzt braucht das Unternehmen andere Prämissen – etwa klare Entscheidungsregeln, eine dokumentierte Strategie oder eine geteilte Führungskultur. Sonst bleibt Orientierung auf der Strecke.
„Verhalten ist Ergebnis von Prägungen – und Prägungen kann man verändern“
Du sprichst von Prägungen – ein schönes Bild. Was meinst Du damit?
Prägungen entstehen aus der Summe dessen, was eine Organisation über Jahre getan, erlebt und gelernt hat. Manche Prägungen sind hilfreich, andere hinderlich. Wenn Du feststellst, dass sich Teams gegeneinander abschotten, Aufgaben doppelt gemacht werden oder Kommunikation klemmt, dann lohnt sich die Frage: Welche Prägungen führen zu diesem Verhalten?
Das ist wie Archäologie. Du musst Schicht für Schicht freilegen, um zu verstehen, warum die Organisation so reagiert, wie sie reagiert. Erst dann kannst Du gezielt ansetzen und neue Prägungen schaffen.
Wie gehst Du da konkret vor, wenn Du Unternehmen begleitest?
Zuerst schauen wir uns an, was eigentlich beobachtbar ist – ohne sofort zu bewerten. Wo läuft Kommunikation gut, wo nicht? Welche Entscheidungen werden schnell getroffen, welche gar nicht? Dann identifizieren wir die Muster dahinter: Sind Rollen klar? Stimmen formale Strukturen mit der gelebten Realität überein? Gibt es Widersprüche zwischen Anspruch und Alltag?
Erst danach geht es um Lösungen. Manchmal braucht es ein neues Organigramm, manchmal andere Meetingstrukturen oder eine neue Entscheidungslogik. Und manchmal einfach nur den Mut, alte Routinen loszulassen.
„Partizipation ja – aber mit klarer Verantwortung“
Wenn man Organisationen offener gestaltet, kann das auch riskant sein. Wo liegen aus Deiner Sicht die größten Stolpersteine?
Ein häufiger Fehler ist, Beteiligung mit Beliebigkeit zu verwechseln. Wenn Du Menschen einlädst, an der Entwicklung ihrer Organisation mitzuwirken, darfst Du ihre Beiträge ernst nehmen – aber Du musst trotzdem entscheiden. Partizipation bedeutet: Ich beziehe Perspektiven ein, bevor ich entscheide. Es heißt nicht: Alle entscheiden alles.
Das zweite Risiko liegt in der fehlenden Klarheit. Wenn Rollen, Befugnisse oder Ziele unklar sind, wird jedes Meeting zur Endlosschleife. Deshalb ist eine klare Entscheidungsarchitektur so wichtig – wer darf was, wer ist wofür verantwortlich, wer muss informiert werden. Das schafft Vertrauen.
Wie gelingt diese Balance in Familienunternehmen, wo Nähe und Struktur oft in Spannung stehen?
Indem Du das eine nicht gegen das andere ausspielst. Familienunternehmen leben von Nähe, Loyalität und Vertrauen – aber sie brauchen auch Strukturen, die diese Werte schützen. Nähe ohne Struktur führt zu Überforderung. Struktur ohne Nähe führt zu Entfremdung. Gute Organisation ist die Balance: klare Regeln, die Raum für Menschlichkeit lassen.
„Gestaltung heißt: Verantwortung teilen, nicht abgeben“
Viele Inhaber fragen sich: Wie viel Verantwortung kann ich abgeben, ohne die Kontrolle zu verlieren?
Die Antwort liegt nicht im Entweder-oder, sondern im Wie. Du gibst Verantwortung nicht einfach ab – Du teilst sie. Das gelingt, wenn alle wissen, worauf sie Entscheidungen stützen sollen. Also wenn Strategie, Entscheidungswege und Kultur zueinander passen. Dann entsteht Vertrauen, weil die Organisation selbst tragfähig wird. Kontrolle brauchst Du dann weniger, weil das System sich selbst stabilisiert.
Was rätst Du einem Unternehmer, der merkt, dass bei ihm „die Verhältnisse das Verhalten“ ungünstig prägen?
Fang mit Beobachtung an. Nicht mit Aktionismus. Frage Dich: Wo genau entsteht das Verhalten, das Dich stört? Welche Bedingungen machen es wahrscheinlich? Und dann geh Schritt für Schritt vor: erst verstehen, dann gestalten. Veränderung ist kein Sturmlauf, sondern Feinarbeit. Und manchmal reicht schon eine kleine Stellschraube, um große Wirkung zu erzielen.
„Nutze das Wissen vieler – und befreie Dich vom Alleinverantwortlichsein“
Zum Schluss: Wenn Du Familienunternehmern einen Gedanken mitgeben könntest – welcher wäre das?
Mach Dich frei von der Vorstellung, alles selbst steuern zu müssen. Du kannst Organisation nicht kontrollieren, aber Du kannst sie gestalten. Und Du bist nicht allein für den Erfolg verantwortlich. Nutze das Wissen Deiner Leute – ihre Erfahrung, ihre Sicht auf Kunden, Prozesse und Kultur. Das Wissen vieler ist die beste Versicherung gegen Betriebsblindheit. Und es ist die Basis, auf der Veränderung wirklich gelingt.
Wenn Sie sich fragen, wie Sie in Ihrem Unternehmen die richtigen Verhältnisse schaffen können – also Strukturen, die Orientierung geben, Verantwortung fördern und Leistung ermöglichen –, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Expertiseseite Organisationsberatung.
Gender Disclaimer
Vielfalt first: Jede Person ist einzigartig. Wir schreiben kurz, klar und bunt – weil’s ums Wesentliche geht. Die maskuline Form dient der Lesbarkeit und ist keine Bewertung. Es lebe der Unterschied!